 zurück zurück |
Kirche |
|
So
klein Dirgenheim mit seinen
heute knapp über 300 Einwohnern auch ist, so kann es doch auf
eine lange Geschichte zurückblicken. Eine Zeit lang
gehörte es zum Hause Öttingen-Wallerstein, dann seit
1803 zu  Württemberg. Eine
eigene Kirche hat es mindestens seit der ersten Hälfte des 13.
Jahrhunderts. Württemberg. Eine
eigene Kirche hat es mindestens seit der ersten Hälfte des 13.
Jahrhunderts.
Aus
dieser Zeit stammt der stämmige Kirchturm, der knapp unter dem
Zeltdach noch romanische Doppelfenster und im Chorraum seines
Erdgeschosses ein auf Konsolen gestelltes Kreuzrippengewölbe
hat. Der quadratische Turm hat offensichtlich alle Widrigkeiten der
Jahrhunderte überstanden: die Heimsuchung des
Dreißigjährigen Krieges, genauso wie die
Dorfbrände 1658, 1752 und 1758. Erst der Sturm der
Neujahrsnacht von 1834/35 wurde über ihn Herr und
riß mit dem Dachgebälk offensichtlich auch einige
Steinlagen herunter. Seitdem hat der Turm sein vierseitiges Zeltdach,
und da die Kirchhofmauer dem sanften Geländeanstieg der
Nordseite des Dorfes folgt, bildeten Turm und Mauer trotzder Kleinheit
des Kirchbezirks
ein Bild voll alter Kraft und gelassener Sicherheit.

Freilich
die nicht geringe Anziehungskraft ging von einem gotischen Kleinod der
Kirche aus: einer farbigen Tonplastik “Maria mit
Kind”, die um 1420 entstanden sein mag. Auch sie wurde in die
neue Kirche mitübernommen.
Auch
wenn Dirgenheim klein war (und noch ist), das in der Barockzeit
verlängerte Schiff war viel zu schmal und kurz, um den
Kirchenbesuchern ausreichend Platz zu bieten. So wurde schon 1902 der
Bauplatz gekauft, auf dem die neue Kirche steht und seit 1909 blieben
Umbau- und Neubaupläne im Gespräch, doch machten
Kriege und Geldentwertungen die gute Absicht zunichte. Erst 1963 war
der Neubaubeschluss perfekt, und nachdem im Juni 1965 auch die
Standortfrage geklärt war, konnte Bischoff Leiprecht am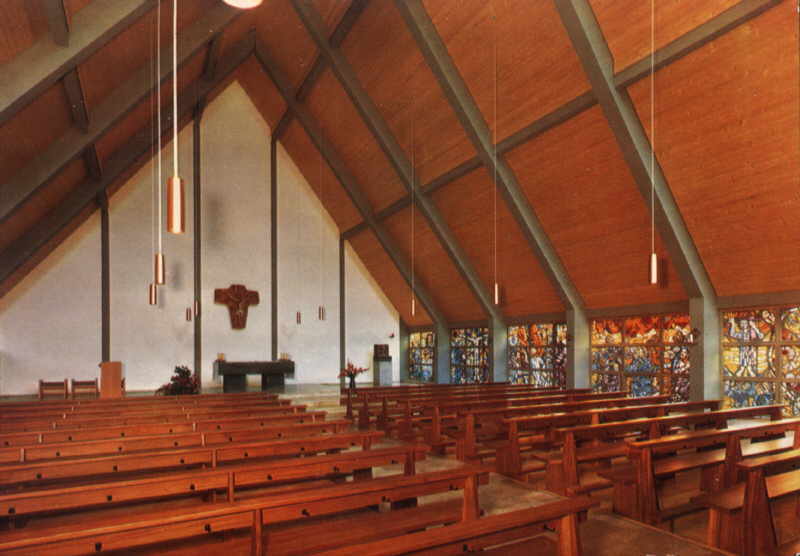 25.Februar 1966 die
Bauerlaubnis geben. Bis September wurde fundamentiert und dann begann
das vielbestaunte Ereignis der Montage. Schon 1963 hatte sich die
Kirchengemeinde für die Fertigbauweise entschieden, das
heißt, für einen Hochbau aus vorgefertigten
Bauteilen.
25.Februar 1966 die
Bauerlaubnis geben. Bis September wurde fundamentiert und dann begann
das vielbestaunte Ereignis der Montage. Schon 1963 hatte sich die
Kirchengemeinde für die Fertigbauweise entschieden, das
heißt, für einen Hochbau aus vorgefertigten
Bauteilen.
Die
neue Kirche erhebt sich nördlich der alten. Sie ist paralell
zu ihr um Längen des alten Schiffes ostwärts
versetzt, so daß im Westen ein Vorplatz entsteht und die
südlich angefügte Sakristei durch einen gedeckten
Gang über den Friedhof hinweg mit dem alten Chorraum verbunden
ist. Die Gestalt des Neubaus ist so einfach wie möglich. Ein
auf einen niedrigen Wandsockel gestellter, von Betonpfeilern
gestützter hoher Giebelbau, der einen holzverschalten Saalraum
mit 250 Sitzplätzen umschließt.
 Der
Altarraum ist mit
Steinweiler Juraplatten ausgelegt. Die Westseite besitzt
außen ein pfeilergestütztes Vordach, das zugleich
ein sehr geschmackvolles Bronzeportal schützt, und innen eine
schlanke Orgelempore, zu der von rechts eine Treppe führt,
während der Raum links vom Eingang ohne besonderen Der
Altarraum ist mit
Steinweiler Juraplatten ausgelegt. Die Westseite besitzt
außen ein pfeilergestütztes Vordach, das zugleich
ein sehr geschmackvolles Bronzeportal schützt, und innen eine
schlanke Orgelempore, zu der von rechts eine Treppe führt,
während der Raum links vom Eingang ohne besonderen baulichen Aufwand geschickt als Taufzone abgeschirmt ist.
baulichen Aufwand geschickt als Taufzone abgeschirmt ist.
Den
Haupteindruck des Außenbaus bestimmt der hohe Westgiebel,
dessen Dreieck ein nach innen hell und schlich wirkendes Glasband knapp
unterhalb des Daches nachzeichnet.
Den
Haupteindruck im Innern bestimmen die fünf großen
Fensterfelder der Südseite. Sie zeigen Motive aus dem Neuen
Testament, wovon eines die Wiederkunft Christi darstellt. Die
kontrastreiche Leuchtkraft dieses Scenen-Zyklus dürfte sie den
Kirchenbesuchern rasch vertraut machen, wogegen sie Zeit brauchen
werden, sich in das schmälere Fensterband auf der Nordseite
einzufühlen
 Es
sind die ersten
Glasbetonfenster dieses durch seine Grafik bereits witbekannten
Künstlers: Sieben Felder mit den Symbolen der sieben
Sakramente, ein Band von strenger und edler grafischer Klarheit, in dem
Strukturen, Farbklänge und Rhythmen einander stützen,
steigern und aussagende Kraft geben. Es
sind die ersten
Glasbetonfenster dieses durch seine Grafik bereits witbekannten
Künstlers: Sieben Felder mit den Symbolen der sieben
Sakramente, ein Band von strenger und edler grafischer Klarheit, in dem
Strukturen, Farbklänge und Rhythmen einander stützen,
steigern und aussagende Kraft geben.
Der
Künstler Hans Majer entwarf auch den Taufstein mit dem
Bronzerelief der Taube, einen Wandteppich mit dem Drachentöter
St. Georg, dem Schutzpatron unserer Kirche, und vor allem das
Altarkreuz für einen gotischen Corpus Christi, das ebenso an
das Motiv des Lebensbaums, wie an das des Marterholzes erinnert.
Ausstattungsstücke,
sowie Tabernakel und Eingangsportal sind alle aus Bronz e
und fügen sich dank ihrer einfachen Formen harmonisch dem
Baucharakter an. e
und fügen sich dank ihrer einfachen Formen harmonisch dem
Baucharakter an.
Ein
Gotteshaus, das in seiner klaren Linienführung, Einfachheit
und Schlichtheit würdig schön ist, dem durchaus nicht
anzusehen ist, daß es eine Kirche mit vorgefertigten Teilen
ist. Durch die Ausstattung der Kirche mit einigen beachtenswerten
Kunstwerken hat sie eine eigene Note erhalten.
Hier
zeigt sich besonders das feine Kunstverständnis des damaligen
Ortsgeistlichen, Pfarrer Schlichter, der in kluger Weise die richtigen
Berater und Künstler ausgewählt hat.
Etwa
200 Meter weiter südlich der beiden Kirchen steht die St.
Annakapelle mit einem achteckigen Dachreiter auf ihrem First.
Über dem Eingang ist die Jahreszahl 1557 angebracht.
|
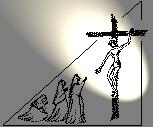 PASSIONSSPIELGRUPPE
DIRGENHEIM
PASSIONSSPIELGRUPPE
DIRGENHEIM